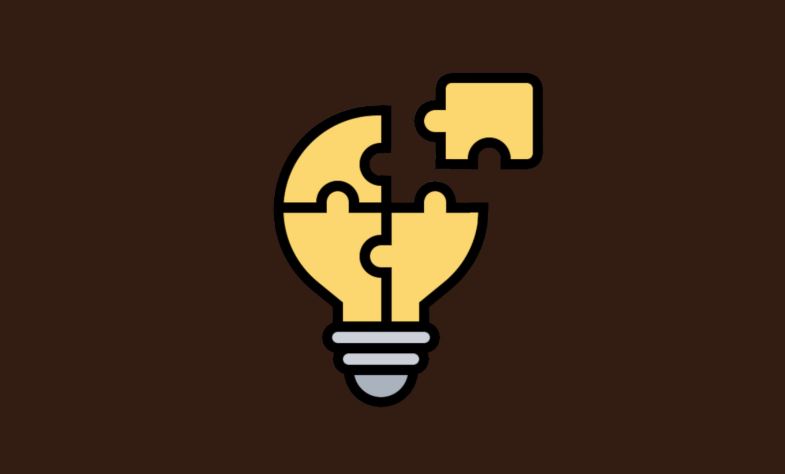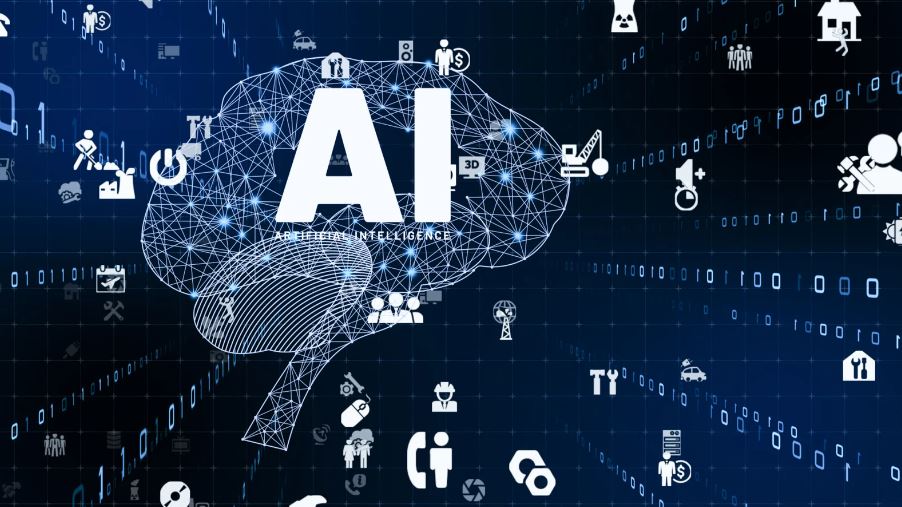Steffen Prang (33 Jahre)
Data-Engineer im Bereich Business-Data-Analytics. Ist verheiratet. Beide sind berufstätig; allerdings ist nur er im Homeoffice. Es gibt einen Hund und ein eigenes Arbeitszimmer.
„Dass Kundenprojekte problemlos remote durchgeführt werden können, war für uns schon vor der Corona-Krise Realität. Geschäftsreisen waren zwar nicht mehr möglich, aber sowohl Projektleitung als auch -durchführung waren aus dem Homeoffice problemlos möglich. Da wir auch vorher schon regelmäßige Webmeetings mit unseren Kunden zur Absprache durchgeführt hatten, waren auch die nichts Neues. Die Digitalisierung ist in unserer Branche sehr weit fortgeschritten, sodass wir keine Probleme hatten, Projekte weiterzuführen.
Geändert hatte sich der Kontakt zu den Kollegen. Der persönliche Austausch – ob offiziell in Präsenzmeetings oder informell in der Kaffeeküche – entfiel komplett und wurde durch virtuelle Kanäle ersetzt. In den digitalen Meetingräumen trafen wir uns für die üblichen Abstimmungsrunden oder für kurzen Small Talk. Wir haben dabei darauf geachtet, die Meetings immer mit Webcam abzuhalten, um den persönlichen Kontakt aufrecht zu erhalten.
Ich denke, dass während der Corona-Zeit ein großes Umdenken in vielen Branchen bezüglich der Digitalisierung und des Arbeitens von zuhause aus stattgefunden hat. In meinen Augen ist das ein positiver Effekt dieser Krise. Homeoffice setzt natürlich das Vertrauen des Unternehmens in seine Mitarbeiter voraus. Bei mir hat das die Motivation gestärkt, denn ich wusste, mir wird zugetraut, meine Arbeit eigenständig organisieren zu können.
Für mich hatte das Arbeiten von zuhause aus mehrheitlich positive Auswirkungen. Privates ließ sich einfacher mit Beruflichem vereinen, und da die Anfahrtszeit ins Büro entfiel, hatte man mehr vom Tag. Die Arbeitszeit blieb zwar gleich, der Sprung in die Freizeit erfolgte dafür sofort – für mich war das ein großes Plus an Lebensqualität.“
Marius Hofmann (39 Jahre)
Entwickler im Bereich Enterprise-Information-Management, arbeitet wie seine Frau reduziert (30 h, 25 h bei seiner Frau). Er hat zwei Kinder, 7 Jahre (Tochter, 1. Klasse) und 4 Jahre (Sohn, Kiga). Arbeitszimmer vorhanden.
„Bei uns sind beide berufstätig: Wir arbeiten beide mit reduziertem Stundensatz (meine Frau 25 Stunden, ich 30 Stunden). Der Sohn geht in den Kindergarten, die Tochter in die erste Klasse. Da ab Mitte März Schule und Betreuungseinrichtungen geschlossen waren, haben wir im Schichtbetrieb gelebt und gearbeitet: Meine Frau arbeitete bis ca. 14 Uhr, während ich die Tochter unterrichtete und den Kleinen betreute. Danach begann mein Arbeitstag, der bis ca. 22 Uhr dauerte. Unterbrochen natürlich vom Abendessen und vom Kinder ins Bett bringen.
Nachdem die Kinder vier Wochen lang keinen Kontakt zu anderen Menschen außer uns hatten, haben wir sie wieder stundenweise von den Großeltern betreuen lassen, da das Infektionsrisiko minimal war. Der Spaß an ‚Mama-Lehrerin‘ und ‚Papa-Kindergärtner‘ war merklich gesunken. So waren wir für die Entlastung sehr dankbar, da es dadurch abends auch nicht mehr so spät wurde. Unser Kindergarten hatte uns bis zu den Sommerferien zwar zwei Tage pro Woche jeweils bis 12.30 Uhr eine Betreuungsmöglichkeit angeboten. Damit wir aber weiterhin die Hilfe der Großeltern in Anspruch nehmen konnten, haben wir dieses Angebot abgelehnt: Zwei Tage bis Mittag ohne Mittagessen bringt relativ wenig Entlastung, da auch die Schule nur alle zwei Tage stattfand.
Wie lief es mit der Arbeit? Grundsätzlich gut. Wir haben ein eigenes Arbeitszimmer, sodass man sich zur Arbeit jeweils zurückziehen konnte. Das war sehr wichtig. Trotzdem blieb die Doppelbelastung durch die unbezahlte Arbeit als Teilzeitlehrer. Die Tage waren lang mit wenig Freizeit, denn vor 22 Uhr war kein Feierabend möglich – und danach stand oft noch Hausarbeit an.
Natürlich haben wir viel mehr Zeit mit den Kindern verbracht. Das war aber keine ‚Quality Time‘ – bis auf das gemeinsame Kochen, das beiden Kindern Spaß macht. Spielen mit dem Kleinen war nur minutenweise möglich, da die Schulaufgaben der Großen regelmäßig meine Aufmerksamkeit und Erklärungen brauchten. Schulaufgaben gab es erst seit Anfang Mai in digitaler Form, vorher mussten sie als Kopien in der Schule abgeholt werden – so viel zum Digitalpakt! Die ersten Wochen bekamen wir keinerlei Rückmeldung der Lehrer, das klappte auch erst auf Bitte der Elternschaft.
Homeoffice war nichts Neues für uns, wir hatten bereits davor zu 20 bzw. 90 Prozent von zuhause aus gearbeitet. Die Umstellung ging recht gut, da die Firma alles Nötige zur Verfügung gestellt hatte. Meine Firma implementiert und entwickelt webbasierte Anwendungen, die wir teils auch einsetzen; deshalb war die Landung in 100 Prozent Homeoffice zum Glück sehr weich. Eine große Umstellung brachte der spätere Arbeitsbeginn mit sich, was von der Abteilung aus zum Glück problemlos möglich war. Ich führe meine Projekte in Eigenverantwortung durch, was auch vonseiten der Kunden ohne Einschränkungen möglich war.
Im Rückblick scheinen viele unserer Schwierigkeiten Luxusprobleme zu sein. Da gibt es Berufe, die mit Familie im Hintergrund wesentlich schwieriger zu handhaben sind. Aber auf Dauer schlaucht es doch etwas! Wir haben deutlich bemerkt, wie viel Arbeit uns die Betreuungseinrichtungen abnehmen und wie wichtig sie für das soziale Leben unserer Kinder sind: Ihnen fehlte der Kontakt zu Gleichaltrigen sehr! Nur Mama und Papa auf Dauer ist einfach öde.”
Simona Gumpert (39 Jahre)
Grafikerin im Marketing, ist verheiratet und hat zwei Töchter, 6 und 2 Jahre.
„Während Homeoffice für mich nichts Neues darstellte, war die Umstellung für mein Team zu Anfang ungewohnt, da einige von 100 Prozent Büropräsenz zu 100 Prozent Homeoffice wechselten. Die virtuellen Teammeetings waren zunächst eine Herausforderung, aber nach einigen Wochen hatte sich alles gut eingespielt und funktionierte reibungslos. Der Firmenchat und die Webkonferenz ersetzten die schnelle Frage rüber zum Tisch des Nachbarkollegen. Nach und nach stellte sich auch heraus, dass Webcalls große Vorteile hatten, da ich trotz der geografischen Distanz mit einem Kollegen den Bildschirm teilen und gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten konnte.
Als Mutter von zwei kleinen Mädchen hatte sich meine häusliche Situation dagegen stark geändert. Meine Töchter hatten „Corona-frei“, Kindergarten und Kita waren geschlossen. Die Familie musste sich daran gewöhnen, dass die Mama nicht stets verfügbar war, selbst wenn sie dauernd zuhause war. Nachdem wir gemeinsam an der Arbeitszimmertür ein Schild für Videokonferenzen angebracht hatten, war auch klar: Nicht reinkommen, sonst bin ich mit im Bild. Das klappte mal mehr, mal weniger gut.
Mein Corona-Arbeitstag startete frühmorgens: Während die Kinder noch schliefen, fing ich an zu arbeiten. Das war ein absolutes Plus und sehr hilfreich, da durch die Umstellung aller Marketingkampagnen auf virtuell/remote viel mehr zu tun war. Unsere zahlreichen Events mussten ins Online-Format übertragen werden, sodass viele neue Tools und Methoden angeschafft und gelernt werden mussten. So verfügen wir heute sogar über ein eigenes Filmstudio, um virtuelle Veranstaltungen in einem attraktiven Format anbieten zu können.
Dadurch, dass die Pendelei ins Büro entfiel, konnte ich sofort nach der Arbeit wieder die Betreuung der Kinder übernehmen. Dieser Zeitbonus war viel wert. Das hört sich aber lockerer an, als es war. Der Stresspegel war hoch, drei Monate lang die Kinder zuhause betreuen und gleichzeitig arbeiten zu müssen, hat sehr an den Nerven genagt. „Dank“ der Kurzarbeit meines Mannes haben wir es aber recht gut gemeistert. Anfang Juli kam dann endlich der Lichtblick, als die Kinder wieder in den Kindergarten gehen durften.“
Johannes Kuhn (31 Jahre)
Teamleiter für das Datacenter und Helpdesk, verfügt über ein eigenes Arbeitszimmer zur Trennung von Berufs- und Privatleben mit elektrisch höhenverstellbarem Tisch und Hometrainer unter dem Tisch, um mal ein paar Minuten in die Pedale treten zu können.
„Mein ‚Corona-Leben‘ war privat eher ruhig, während beruflich viel los war. Für mich als Teamleiter für die Bereiche Datacenter und den Helpdesk war aus dem Homeoffice eine deutlich bessere Kommunikation nötig als vorher.
Da ich keine Kinder habe, hielt sich die Ablenkung zuhause zum Glück in Grenzen. Ich verfüge über ein eigenes Arbeitszimmer, sodass die Trennung von Berufs- und Privatleben gut möglich war. Mein Schreibtisch ist nicht nur höhenverstellbar, sondern ich hatte darunter sogar einen Hometrainer installiert, sodass ich zwischendrin immer mal wieder ein paar Minuten in die Pedale treten konnte. Diese körperliche Abwechslung hat sicher zum Stressabbau beigetragen.
Mein Tagesablauf hat sich während Corona ehrlich gesagt gar nicht so sehr verändert im Vergleich zu vorher, als ich meinen Arbeitstag noch zu 100 Prozent im Büro verbrachte. Der Arbeitstag wurde nur dynamischer: Je nachdem, ob nachts in der IT etwas Unvorhergesehenes passiert war, begann die Arbeit manchmal schon vor dem Zähneputzen. Wie vor Corona hatte ich regelmäßig Meetings mit den einzelnen Teams und dem Management, nur eben virtuell. Dazu gab es Online-Kaffeepausen mit den Kollegen, um sich auszutauschen. Manche Kollegen nahmen das gerne an, für andere blieb eine Videokonferenz weiterhin etwas Gewöhnungsbedürftiges.
Was hat sich verändert? Das virtuelle Arbeiten erforderte eine andere Feedback-Kultur und Kommunikation. Das Weniger an persönlicher Kommunikation bedeutete zunächst einen gewissen Informationsverlust, nämlich den der Körpersprache oder Stimmlage. Schriftlich oder im Chat können schnell Missverständnisse entstehen – sei es bei der Aufgabenstellung oder bei einer Zwischenfrage, die flapsig beantwortet wird. Nimmt der Empfänger die Kommunikation negativ auf, so kann schnell Frust entstehen. Dem bin ich mit mehr Interaktionen und den richtigen Tools für einen mühelosen Austausch entgegengetreten. Die Betonung liegt auf ‚mühelos‘ – und der Austausch gilt beidem, dem Fachlichen und dem Zwischenmenschlichen. Einige meiner Mitarbeiter passten sich schnell an die Umstellung von persönlichem zu virtuellem Kontakt an, andere taten sich mit einer Kamera vor dem Gesicht eher schwer.
Überraschenderweise zeigten selbstverständliche Werkzeuge wie das Headset, das Notebook, der VPN-Zugriff, das Webmeeting oder bestimmte Anwendungen ihre Tücken: Selbst wenn alles schon zigfach erfolgreich benutzt worden und erprobte Technik war, funktionierte dennoch immer wieder irgendwas nicht – und sei es nur eine der drei Mikrofon-Stummtasten, die noch aktiv war.
Ich habe gelernt, dass die Teampflege wichtiger denn je war – vor allem eine ausgeglichene Behandlung aller Mitarbeiter. Natürlich pflegt man zu dem ein oder anderen einen intensiveren Kontakt. Deshalb musste ich darauf achten, dass introvertiertere Kollegen nicht abgehängt, sondern integriert wurden. In puncto Vertrauen hatte ich weniger Probleme, denn auch vor Ort im Büro überprüfe ich nicht die ganze Zeit, ob die Mitarbeiter hochmotiviert und diszipliniert arbeiten. Aus der Distanz lassen fehlende Statusmeldungen aber viel schneller Zweifel aufkommen. Ob sie gerechtfertigt sind? Wohl kaum ...
Fazit: Die Service-/Leistungseffektivität war bei uns im Bereich Datacenter und Heldpesk trotz Homeoffice sehr gut – oder viel eher: wegen Homeoffice. Weil viele äußere Störfaktoren wegfielen, wurde effizienter gearbeitet, was den Kollegen guttat. Dennoch kam es manchmal vor, dass trotz Fleiß eine Service-Schuld aufgebaut wurde, ohne es zu bemerken. Hier lernte ich, doppelt aufmerksam zu sein.“