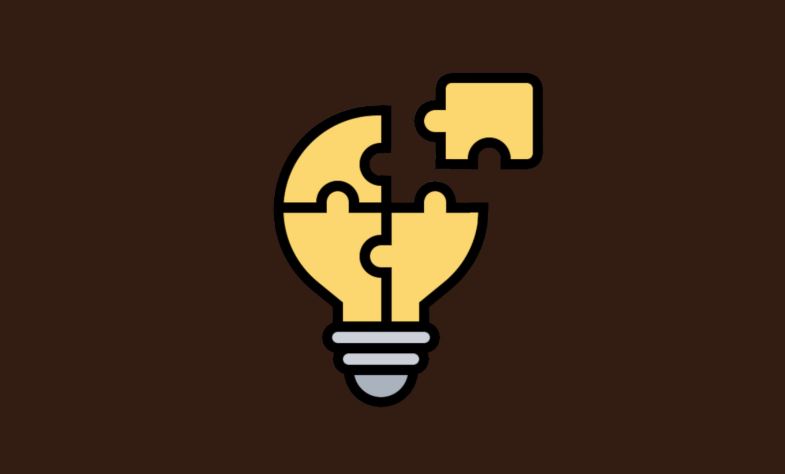Johannes Mainusch: Susanne, du bist Informatikprofessorin an der Universität Oldenburg in Oldenburg. Ich weiß gar nicht, ob man das zweite Oldenburg noch mal extra betonen muss.
Susanne Boll: Aber klar, denn es gibt in Norddeutschland noch ein weiteres Oldenburg, nämlich in Schleswig-Holstein, und spätestens, wenn du uns besuchen kommst, solltest du das wissen. Es gibt eine Anekdote, dass ein schon dringend vermisster Referent während der bereits laufenden Veranstaltung aus Schleswig-Holstein anrief, weil er genau das falsche Oldenburg per Zug erreicht hatte. Er nahm sich damals dann schnell einen Mietwagen und fuhr in unser Oldenburg. Sein Vortrag wurde dann natürlich später im Programm platziert. Verwechslungen der zwei Städte kommen also vor.
„OFFIS ist der zentrale Grund, der mich hier in Oldenburg gehalten hat”
Ist Oldenburg auf der IT-Landkarte in Deutschland also noch nicht so bekannt?
Oldenburg liegt im Nordwesten Deutschlands und ist eine sehr schöne, idyllische Stadt mit rund 170 000 Einwohnern, die sich weiterhin Wachstum und Entwicklung vorgenommen hat. Wir liegen hier geografisch sehr dicht an den Niederlanden, Amsterdam ist für uns nicht viel weiter weg als Hamburg, und so pflegen wir auch sehr gute Beziehungen zum benachbarten Groningen. In Oldenburg sitzt die Universität Oldenburg, die vor einigen Jahren ihr 40-jähriges Universitätsjubiläum gefeiert hat. Sie war zuvor eine pädagogische Hochschule und spielt deshalb in Niedersachsen eine nach wie vor wichtige Rolle in der Lehramtsausbildung. Die Universität selbst hat ein beachtliches Wachstum hingelegt, wir haben jetzt 15 000 Studierende, als ich vor 20 Jahren kam, müssten es bereits ca. 11 000 gewesen sein. In diesen Jahren hat sich auch die Informatik wirklich exzellent entwickelt. Neben meiner Professur an der Hochschule engagiere ich mich auch für OFFIS. Vor 30 Jahren wurde es als Transferinstitut gegründet, mit dem Zweck, die Wirtschaft in der Region mit der Informatik zu verknüpfen, also eine Brücke zwischen Forschung und Anwendung zu schlagen. OFFIS hieß damals noch „Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik, Werkzeuge und Systeme”. Heute heißt es nun OFFIS – Institut für Informatik. Das Forschungsinstitut hat sich hervorragend entwickelt und ist der zentrale Grund, der mich hier in Oldenburg gehalten hat. Ich hatte interessante Rufe an andere Orte, zum Beispiel Wien, Klagenfurt oder Hamburg, aber das OFFIS mit seinen Themen und einer Größe von über 300 Mitarbeiter•innen und studentischen Mitarbeiter•innen ist einfach ein tolles Umfeld für meine Forschung. Ich bin seit 2013 Mitglied im Vorstand und kann die Geschicke des Institutes mit leiten.
Wenn man sich das klarmacht mit Zahlen, Daten, Fakten, dann ist rund jeder 11. Oldenburger ein Student an eurer Universität. In Hamburg kommen wir da überhaupt nicht auf den Faktor, da ist das vielleicht jede vierzigste Person ...
Das liegt sicher auch daran, dass Oldenburg auch von der Geografie her schön ist und im Gegensatz zu den großen Städten noch bezahlbar, das macht es für Studierende natürlich zusätzlich attraktiv. Es gibt hier viele bundes- und europaweit sichtbare Player, im Verhältnis zu der Größe der Stadt, die im Rahmen der Digitalisierung eine immer stärkere Rolle spielen. Beispielsweise haben wir in Oldenburg das einzige, in Deutschland geförderte Pflegeinnovationszentrum in der Ausschreibung „Zukunft der Pflege” des Bundes gewinnen können. Man hätte erwarten können, das geht an einen der großen Bewerbungsstandorte, aber nein, das kleine Oldenburg im Nordwesten hat den Zuschlag bekommen! Wir haben eben konsequent Digitalisierung, Gesundheit und Pflege ausgebaut und zusätzlich die Universitätsmedizin aufgebaut. Da wurde von außen schon kritisch geschaut, wie man es wagt, in Deutschland nach 20 Jahren wieder einen neuen Standort für Medizin zu gründen. Noch dazu hoch im Norden in Oldenburg und grenzüberschreitend mit den Niederlanden Unser Standort ist klein, aber er hat eine hohe Dynamik. Ich freue mich schon auf unser nächstes Langzeitprojekt, für das wir Fördermittel von Bund und Land bekommen haben: das Innovationsquartier Oldenburg, mit OFFIS als treibende Kraft. Unser Ziel ist es, einen Leuchtturm der Digitalisierung im Norden zu bauen. Dazu bündeln wir die Kräfte vor Ort, mit dem lokalen DFKI, dem DLR Systems Engineering für zukünftige Mobilität und der Universitätsinformatik in einem Campus. Alles mit dem Ziel, Industriekooperationen, Gründung von Unternehmen mit Ausbildung und Forschung noch stärker zu integrieren und den Raum für Innovationen weiter wachsen zu lassen. Das wird sicherlich für Oldenburg den nächsten großen Schub geben.
„Wir werden in Oldenburg einen Leuchtturm der Digitalisierung bauen”
Oldenburg wird also eine Stadt, in die dann viele Leute ziehen, um dort zu studieren ...
Ja, das würden wir aber gern noch verstärken. Bei uns ist das so, im Bachelor studiert man schon noch gern in der Region, wie an den meisten Universitäten. Dann kommen zunehmend Studierende von außerhalb, und hier sehen wir schon tolle Profile. Mein persönliches Interesse ist dabei die Mensch-Technik-Interaktion. Wir haben hier eine sehr starke Verbindung der Informatik mit der neurowissenschaftlichen Psychologie/Kognitionspsychologie, sodass wir gemeinsam einen neuen Studiengang entworfen haben: den englischsprachigen Master-Studiengang Engineering of Socio-Technical Systems (EngSTS), der genau an der Grenze von Psychologie, Neurowissenschaften und Informatik liegt. Wenn wir digitale Systeme der Zukunft bauen wollen, dann sind die soziotechnischen Aspekte eng mit den technologischen Aspekten verknüpft.
Da fällt mir sofort Karlheinz Brandenburg ein und die Erfindung von MP3. Auch da kamen mit der Psychoakustik und digitalen Signalprozessoren zwei fernliegende Zutaten in den Innovationstopf. Das heißt, diese vermeintlich fernliegenden Wissen- schaftsbereiche wie Psychologie und Informatik zusammenzubringen, hat Innovationspotenzial?
Ja, definitiv. Vor ein paar Wochen habe ich eine Keynote zur Eröffnung der KIT Science Week gehalten, in der ich in acht Thesen zusammengefasst habe, wie wir eine menschenzentrierte KI entwickeln können. Für mich ist es ein zentrales Thema, dass man Digitalisierung mit und für den Menschen gestaltet und nicht einfach Technologie abliefert, beispielsweise bei Pflegekräften, und sagt: Das ist jetzt euer neues Interface für die Alarmweiterleitung, viel Spaß. KI und Digitalisierung mit dem Menschen zusammen zu entwickeln, ist mir ein extrem großes Anliegen. Ich glaube, da stehen wir bei vielen Dingen immer noch am Anfang. Es ist wichtig, um beim Beispiel zu bleiben, Technologien gemeinsam mit Pflegekräften zu entwickeln, damit es in deren Arbeitsalltag auch richtig integriert wird (siehe Abbildung 1). Wir fördern ebenso ganz bewusst Tandemprojekte zwischen den Sozialwissenschaften und der Informatik. Beispielsweise zu der Frage: Welche Interaktionen akzeptieren Menschen im Umgang mit KI? Etwa wenn der Reisepass auf dem Bürgeramt verlängert wird oder eine Person innerhalb des Ermessensspielraums sagt, das Bußgeld wird nicht fällig. Was wäre also nun, wenn eine Maschine diese Entscheidungen trifft? Was bedeutet das dann im Umgang und auch in der Entwicklung solcher Systeme? Wie können wir Aspekte von Akzeptanz von vornherein einbauen? So Informatik für den Menschen zu gestalten, begeistert mich.

Abb. 1: Augmented Reality in der Pflege, Assistenzsysteme Opticare, Pflegeinnovationszentrum
„Wenn wir digitale Systeme der Zukunft bauen wollen, dann sind die soziotechnischen Aspekte eng mit den technologischen verknüpft”
Kommen viele Studierende von außerhalb nach Oldenburg? Seid ihr international?
Wir sind international und wollen durch den Ausbau englischsprachiger Studiengänge auch noch mehr internationale Studierende für Oldenburg gewinnen. In dem erwähnten, neuen und englischsprachigen Master-Studiengang Engineering of Socio-Technical Systems haben wir viele internationale Bewerbungen. Und das, obwohl er mit nur 25 Studierenden pro Jahr sehr klein ist. Das kommt zum einen durch die Sprache, aber vor allem auch durch die Zulassung aus verschiedenen Fachrichtungen, denn man kann sich sowohl aus der Richtung Psychologie als auch Informatik für den Studiengang bewerben.
Mit diesen und weiteren internationalen Studiengängen hat sich Oldenburg in Richtung Internationalisierung gut entwickelt und wird das auch weiter tun.
Ist da die Grenzregion zu den Niederlanden auch entscheidend?
Ja, der neue Studiengang Medizin wurde gemeinsam mit der Universitätsmedizin Groningen in der gemeinsamen European Medical School Oldenburg-Groningen entwickelt. Es gibt einen festen Austausch, das heißt, unsere Studierenden gehen nach Groningen und die aus Groningen kommen zu uns, daher auch die Bezeichnung European Medical School. Was uns hier grundsätzlich hilft, ist, dass Oldenburg sehr kurze Wege hat. In Oldenburg ist man wirklich hervorragend vernetzt, die Universität, das OFFIS, die regionalen Unternehmen, die Kommune, aber auch neue Initiativen am Standort, wie beispielsweise das CORE, ein Coworking und meeting place. Das CORE wurde durch regionale Architekten und Investoren vorangetrieben. Wir sind mit OFFIS als Partner dabei, weil wir die Räumlichkeiten gut nutzen und den Austausch so weiter fördern können. Wiederum sind die hiesigen Industrieunternehmen, wie etwa CEWE, wichtige Partner in der Region. Die Unternehmen schätzen die Universität als ihre ihre regionale Institution, die den Zustrom an hoch ausgebildeten Fachkräften extrem fördert. Das heißt, es gibt in Oldenburg viele Player die, wohlwollend und für die gemeinschaftliche Sache, Dinge mit entwickeln und unterstützen. Ich glaube, dass generell die Attraktivität kleinerer Städte größer wird, Menschen sich durchaus mehr von den sehr teuren Städten zurückziehen und sich in Städten mit einer Dynamik wie Oldenburg ansiedeln, wo es schon viel Kultur und Kneipen gibt, aber alles etwas überschaubarer ist.
Ihr müsstet nur englischsprachiger werden, dann würde halb Berlin zu euch kommen, weil es in Oldenburg noch Kita-Plätze gibt, die in Berlin rar sind ...
Halb Berlin wäre vielleicht dann doch wieder etwas viel … Aber ja, das ist ein guter Hinweis, der wird aufgegriffen. Das OFFIS-Institut selbst ist zumindest englischsprachig, da wir sehr diverse Teams aus vielen Ländern haben. So gibt es entsprechend viele Arbeitsgruppen, in denen Englisch Alltagssprache ist.
Diversität und Frauen in der Informatik sind ein Riesen-Thema ...
Ja, auch ein wichtiges Thema für mich persönlich, und zwar nicht nur für die Frauen, die ich ausbilde, sondern für unsere Gesellschaft als Ganzes. Die Förderung von Frauen in Führungspositionen ist mir wichtig, weil ich weiß, dass es nach wie vor eine große Herausforderung darstellt. Aus meiner Sicht wird sich nach all den Jahren nur etwas ändern, wenn auch die große Menge der Herren dafür aufsteht. Wir brauchen einen Kulturwandel, dazu müssen wir Männer und Frauen haben, denen es wichtig ist, den voranzutreiben. Ich bin immer noch gefühlt jeden Monat einmal in einem Gremium, in dem man komplett vergessen hat, sich um eine angemessene Beteiligung von Frauen und Männern zu kümmern. Wenn ich so etwas erlebe, dann trete ich wieder aus.
Die Hamburger Strategietage haben das auch jahrelang nicht kapiert. Ich glaube, ein wesentlicher Schritt, um in dem Punkt weiterzukommen, ist Internationalisierung in der IT. Am Beispiel Berlin sehe ich, wie der Freiraum, der dort in den letzten 30 Jahren bestand, einen Nährboden für Multikultur erzeugte, der quasi automatisch Diversität schuf. Und aus den IT-Kulturen in Indien oder Ägypten kommen viele Frauen mit IT-Know-how, denn die machen dort 30 bis 50 Prozent in den Studiengängen aus. Deshalb habe ich das vorhin mit dem Englisch gefragt. Ist Englisch die Lingua franca der Informatik?
Absolut! Meine Mitarbeiter•innen kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern mit einem sehr interkulturellen Hintergrund. Vor etwa 20 Jahren in Wien gab es ein Plakat, das sagte, wenn wir in diesem Tempo weiter Frauen als Professorinnen an den Universitäten einstellen, kommen wir im Jahr 2300 bei der Parität an. Das erinnert mich ein bisschen an Fridays for future, die auch sagen: Leute, jetzt gehen wir schon so lange auf die Straße, aber getan hat sich bei Weitem nicht genug. Da stellt sich die Frage: Was für eine zukünftige berufstätige Generation bringen wir auf den Weg? Tun wir genug, damit auch Frauen an dieser digitalen Gesellschaft teilhaben und sie mitgestalten können?
Und dahinter die Frage, begreifen wir Diversität insgesamt als einen Wert?
Genau! Je länger ich in meinem Job bin, desto mehr empfinde ich zwei Dinge als ein echtes Geschenk: die Forschung selbst und dass mir täglich immer neue Menschen begegnen. Ich darf mit ihnen arbeiten, Diskurse führen, manche promovieren bei mir und einige darf ich über viele Jahre begleiten. Sie alle bringen immer neue Impulse und Vielfalt in mein Leben. Sie kommen mit ihrer Jugend und ihrer Weltanschauungen, mit ihrer Gesellschaftskritik und mit ihren politischen Vorstellungen, das ist ein Riesengeschenk!
Beeinflusst Diversität auch die Ergebnisse von Forschung?
Es gab dieses Jahr eine sehr interessante Keynote von Ruha Benjamin auf der Konferenz über Human Computer Interaction. Ruha Benjamin ist eine afroamerikanische Forscherin aus den USA, die sich mit Ungleichheit in unserer, auch digitalisierten, Umgebung auseinandersetzt (siehe Abbildung 2). Die Frage war, für welche Menschen designen wir eigentlich? In der Keynote wurde die junge Forscherin Joy Buolamwini vorgestellt, die persönlich die Erfahrung machte, dass die Gesichtserkennung oft nicht richtig funktioniert. Sie hat es daraufhin systematisch analysiert, indem sie alle online verfügbaren face recognitions der großen Firmen untersuchte und verglich, white face/white man/black face/ black woman/black man. Tja, und leider kaum überraschend: Die schwarze Frau war am Ende der Fahnenstange. Eine hervorragende Arbeit, die sie im Anschluss veröffentlichte. Sie hat damit Firmen bewegt und erreicht, dass Gesichtserkennung besser geworden ist. So etwas finde ich superspannend. Diese Reflexion, wo unsere Digitalisierung zutiefst ungerecht und zutiefst diskriminierend ist, finde ich ungeheuer wichtig. Wir müssen uns als Gesellschaft auf den Weg machen, denn Digitalisierung der Gesellschaft heißt natürlich für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für diejenigen, die technologieaffin sind oder für die in gut bezahlten Jobs.

Abb. 2: Video: Ruha Benjamin: Which Humans? Innovation, Equity, and Imagination in Human-Centered Design (Keynote), ACM SIGCHI, Mai 2021 (QR-Code: https://youtu.be/kDcz44ifdQw)
„Warum greifen wir immer wieder auf Stereotype zurück?”
Die Aufgabe einer KI ist es, zu unterscheiden, also in technischer Weise zu diskriminieren. Offenbart hier also eine auf Diskriminierung trainierte KI gesellschaftlichen Rassismus?
Ja, wobei es beim Bilderkennungsbeispiel gar nicht so einfach ist, wen ich denn jetzt in Verantwortung sehe. Wer hat das zum Training der KI verwendete Bildmaterial ausgewählt? Ist hier eine Entwicklerin oder ein Entwickler schuld, weil sie oder er nicht bemerkte, dass es sich um eine einseitige Abbildung der Gesellschaft handelt? Werden weniger Bilder in öffentlichen Sammlungen von People of Color veröffentlicht? Eines unserer Projekte beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Pflegeroboter in der Zukunft aussehen könnte. Muss die Robotik unbedingt so aussehen wie eine Frau oder ein Mann? Warum greifen wir immer wieder auf Stereotype wie die nette Krankenschwester mit der freundlichen Stimme zurück? Können wir nicht etwas konzipieren, was sich von den heutigen Stereotypen löst? Will ich denn heute eine Technologie bauen, die mich in 20 oder 30 Jahren unterstützt, und die dann die überkommenen Stereotype aus den 20er-Jahren abbildet, das ist doch irre.
Und habt ihr Erkenntnisse darüber, ob das funktionieren kann, oder wünschen sich die Menschen doch lieber nette, warmherzige Krankenschwestern?
Wir haben lange über das Studiendesign diskutiert und haben uns dann dafür entschieden, diesen Vergleich einfach sein zu lassen. Daher haben wir Eigenschaften abgefragt, die sich mit Wärme und Kompetenz assoziieren lassen. Wir haben untersucht, mit welchen Gesten, visueller Erscheinung, Bewegung usw. dies abgebildet werden kann, also wie Wärme und Kompetenz abbildbar sind. So haben wir mithilfe von Interviews einen Virtual-Reality-Roboter gebaut, also ein möglichst neutrales 3-D-Modell. Dann haben wir dem neutralen Roboter verschiedene behavioral cues, also Verhaltensanstöße, gegeben, um zu untersuchen, ob wir in der späteren Bewertung Elemente wie Wärme oder Kompetenz abbilden können. Dabei sind wir eben gerade nicht mehr auf dieses more female oder more male eingegangen. Wir sind aber noch weit vom Ziel entfernt, es war die erste Studie in diesem Kontext.
Das heißt, ihr destilliert die Grundessenz von Wärme und Vertrauen heraus, ohne irgendwelche Brücken-Metaphern wie Mann und Frau zu verwenden.
Ganz genau. Wir entgendern die KI und versuchen so, Diskriminierung zu vermeiden. Einfach KI für und mit den Menschen gestalten.
Susanne, vielen Dank für das Gespräch.

Abb. 3: Interaktion von Mensch und Roboter in der Produktion